

Drei kleine Wörter – “Just a PoC” – können eine ganze KI-Initiative zum Scheitern bringen.
Zu oft werden Proof of Concepts (PoCs) als psychologische Beruhigungspille genutzt: klein, günstig, harmlos. Ein Experiment auf der Spielwiese, das schon irgendwie zeigt, dass „man mal was gemacht hat“.
Genau hier liegt die Gefahr. Denn ein PoC ist kein Spielplatz. Er ist ein Entscheidungstool.

Ein PoC ist dann wertvoll, wenn er diszipliniert durchgeführt wird und in kurzer Zeit belastbare Antworten liefert. Dafür braucht es klare Spielregeln:
Das Ergebnis: Führungskräfte erhalten schnell die Antwort, die sie brauchen – funktioniert die Idee oder nicht?
Nehmen wir ein Beispiel: Die Automatisierung eines bestehenden Prozesses mit KI.
1. Reale Inputs statt Laborbedingungen.
Statt künstlich vereinfachter Testdaten wird das System mit echten, unordentlichen und unvollständigen Daten gefüttert. Nur so zeigt sich, ob es auch außerhalb der Laborsituation funktioniert.
2. Konkrete und vollständige Prozessbeschreibung.
Viele PoCs scheitern daran, dass der „menschliche Layer“ zu vage beschrieben wird. Wichtig ist: Erst wenn explizite Handlungen und implizite Kontexte sichtbar sind, kann KI wirksam automatisieren.
3. Harte Benchmarks statt weicher Ziele.
Erfolg muss messbar sein:
4. Klare Grenzen für Budget, Laufzeit und Iterationen.
Zum Beispiel: „4 Wochen, maximal 5 Iterationszyklen, Budgetdeckel bei 25.000 €.“ Solche Grenzen verhindern, dass PoCs endlos weiterlaufen.
5. Run, validate, decide.
Am Ende gibt es nur zwei Ergebnisse:Es gibt immer genügend neue Ideen – entscheidend ist, dass jede einzelne schnell auf ihre Tragfähigkeit geprüft wird.
Richtig aufgesetzte PoCs geben Sicherheit. Sie zeigen, ob ein Use Case tragfähig ist – oder eben nicht.
Das bedeutet:
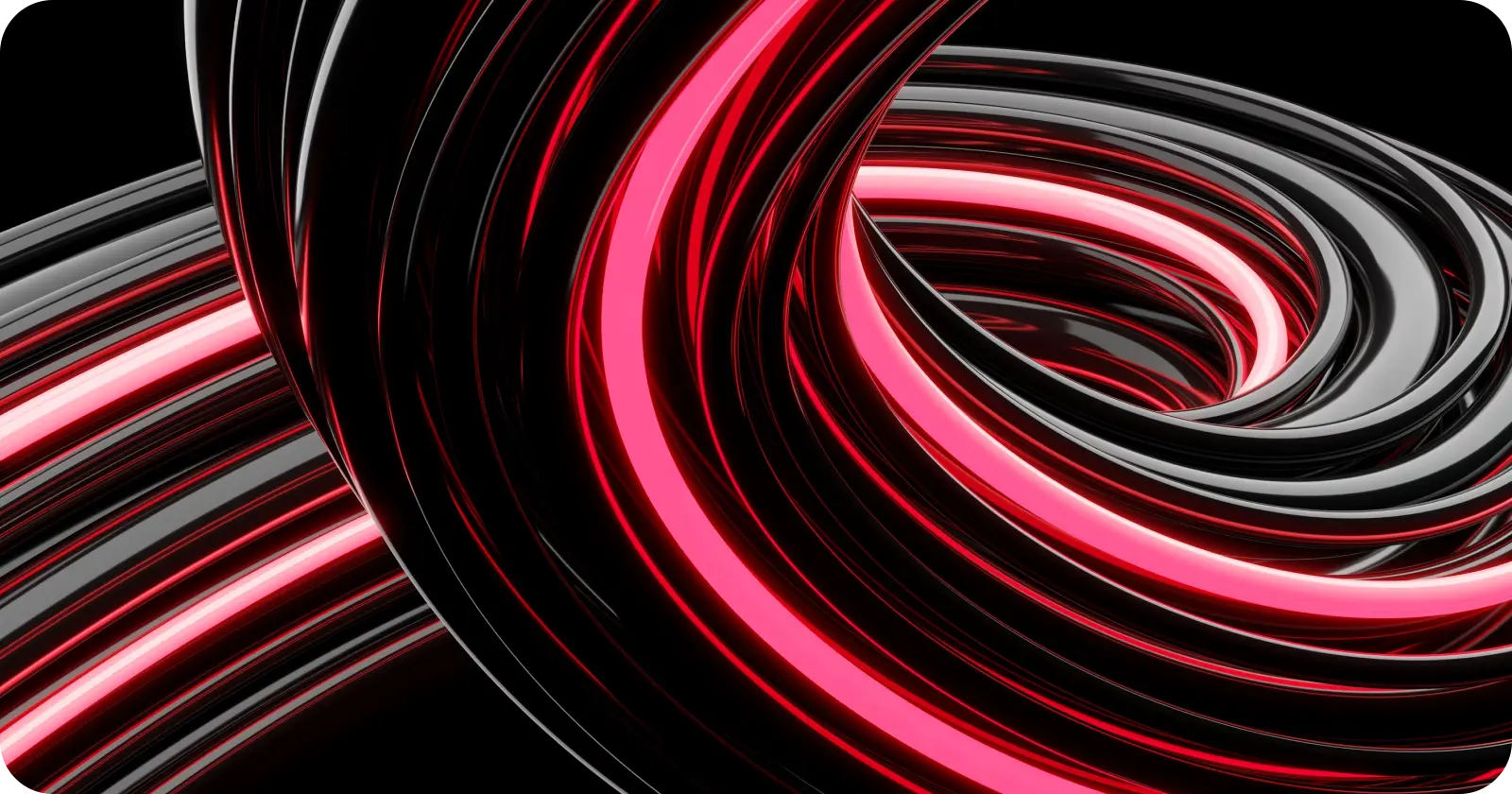
Ein Proof of Concept ist kein Feigenblatt und kein Spielzeug. Er ist ein Instrument für Klarheit. Entweder er liefert den Beweis, dass es funktioniert – oder den Beweis, dass es nicht funktioniert. Alles dazwischen ist vergeudete Zeit.
Ob und wie künstliche Intelligenz Ihr Geschäft wirklich voranbringen kann, finden wir in einem ersten, unverbindlichen Gespräch gemeinsam heraus.
In diesem Gespräch erfahren Sie:
.svg)
.svg)
.jpg)